Zentrale Fragen zur Sterbebegleitung
- Susanne
- 2. Juni 2025
- 5 Min. Lesezeit
Teilnehmende stellen Fragen - Einblick in den Kurs Systemische und resonanzbasierte Tierkommunikation (mit Aufstellungen und einem Einblick in die Sterbebegleitung), Kientalerhof 30.5.-1.6.2025

Den Teilnehmenden wurde die Möglichkeit gegeben, ihre eigenen Fragen zum Thema Sterben und Sterbebegleitung zu formulieren. In diesem Artikel will ich auf einige Punkte eingehen.
Wie sehe ich Schmerzen und Leid in einem Tier?
Schmerzen sind oft nicht wirklich zu erkennen, wenn sie nicht wirklich stark sind. Starke Schmerzen zeigen sich in Apathie, Zurückgezogenheit, dem «Schmerzgesicht», der Verweigerung der Nahrungsaufnahme. Es ist sehr wichtig, Schmerzen zu erkennen und auch zu behandeln. Wenngleich ich denke, dass auch Tiere wie wir Menschen zu einem gewissen Grad körperliche Schmerzen aushalten können. Bei der holistischen Sterbebegleitung spielt das Schmerzmanagement eine wichtige Rolle und sollte durch einen Tierarzt oder einer Tierärztin begleitet werden. Es gibt «Pain Scores», die auch illustriert und auf das jeweilige Tier angepasst sind.[1]
Wann braucht es eine aktive Unterstützung von mir, wann soll ich einen Arzt beiziehen?
Bei akuten Krankheitsfällen natürlich sofort, bei chronischen Krankheiten empfiehlt es sich, ein Protokoll zu führen, in dem Verhaltensänderungen, Essverhalten und wie abgesetzt wird, notiert werden. Bei chronischen Krankheiten scheint es mir wichtig, nicht in einen Aktivismus zu verfallen, sondern in achtsamer Ruhe das Tier zu begleiten. Erst in achtsamer Ruhe merken wir, was das Tier braucht. Im Falle einer holistischen Sterbebegleitung ist es ratsam, eine erfahrene und ausgebildete «End of Life Doula» an der Seite zu haben sowie einen Tierarzt/eine Tierärztin, die in diesen Prozessen zumindest informiert sind (v.a. in Bezug auf Schmerzmanagement). Es ist besser, sich früh genug darüber zu informieren.
Trauerarbeit beim Tod eines Tieres und die Konfrontation von Glaubenssätzen, wie gehe ich damit um?
Es kann vorkommen, dass das Umfeld auf den eigenen Schmerz über den Verlust des eigenen Tieres nicht verständnisvoll reagiert. Es fallen dann Sätze wie, «hol’ dir am besten bald einen neuen Hund», «sterben müssen wir alle», oder «das war doch nur ein Tier.» Hier rate ich, sich zu überlegen, wer denn die eigene Trauer verstehen könnte und ob es die Möglichkeit gibt, mit jemandem über den Verlust zu sprechen. Nach Francis Weller, einem Psychologen und Spezialisten in Trauerarbeit, sollte der Ausdruck von Trauer in einem Dialog mit anderen Menschen stattfinden – idealerweise. Durch das Zuhören alleine, dass ohne Bewertung stattfinden, kann diese Trauer gemildert werden. Er sagt auch – Trauer ist ein Zeichen von Liebe. Sie gehören zusammen und müssen – sollten – gar nicht verschwinden. Es ist Teil unseres Wesens.
Der plötzliche Verlust eines Tieres vs. der längere Weg bis zum Tod (z.B. bei Krebs) – wie gehe ich damit um?
Beide Verluste benötigen verschiedene, aber dann auch wieder die gleichen Erkenntnisse für einen friedvollen Umgang. Der plötzliche Tod kommt als Schock und es besteht keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wir wissen aber, dass es diesen unerwarteten Tod gibt, bei Mensch und bei Tier. Ist ein Tier chronisch krank, bedeutet die Zeit bis zum Tod oftmals eine Zeit, die sehr anspruchsvoll sein kann. Denn das Tier braucht ggf. spezielle Behandlungen, sein Körper verändert sich, was für Mensch und Tier ein Prozess ist, der zuerst angenommen werden muss. Es kommen Kosten auf und vielleicht ist auch das ein belastendes Thema. Phasen der Erschöpfung, der vorweggenommenen Trauer, auch der Ruhe in Zeiten der Stagnation folgen im Wechsel. In allen diesen Momenten ist es sehr wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben und Menschen zu suchen, die wertfrei unterstützen. Ein krankes Tier bis zum Lebensende zu begleiten, ist alleine fast nicht möglich, denn gerade in der letzten Phase bedeutet dies, wie beim Menschen, eine ununterbrochene Präsenz. Was macht das mit dem Betreuenden? Es ist eine bereichernde Erfahrung, wenn wir unsere eigenen Gefühle, die unweigerlich aufkommen, in Wärme anerkennen und diese als Geschenk einer Veränderung ansehen. Die Aufgabe ist, unsere eigene Angst und die Erschöpfung mit uns und unseren Helfern abzufedern, damit das Tier nicht den Eindruck bekommt, es muss sich noch um uns kümmern. Das ist in meiner Erfahrung die grösste Herausforderung für Menschen.
Wie gehe ich mit der Verantwortung um, schwierige Entscheidungen treffen zu müssen, wie bspw. ein Tier gehen zu lassen?
Wir Menschen sind verantwortlich für unsere Tiere, die in unserer menschlichen Welt leben. Das gilt bis zum Lebensende. Falls ein natürlicher Tod nicht möglich ist, dann müssen wir auch den Entscheid für eine Euthanasie treffen, wenn es im Sinne und entsprechend des körperlichen Zustandes des Tieres angezeigt ist. Falls möglich, dazu rate ich immer, sollte sich der Mensch für diesen Entscheid Zeit nehmen. Es gibt Situationen, in denen die Zeit nicht da ist, z.B. wenn das Tier zu ersticken droht. Oft ist die Zeit aber da. Lass dich nicht durch einen Tierarzt drängen, ein guter Tierarzt wird das nicht machen. Auch hier, wenn du in einer inneren Ruhe bist, kannst du den Moment besser spüren. Dazu braucht es vorweg Übung in Achtsamkeit, um in einer angespannten Situation in diesen Moment der Verbindung mit sich selbst gehen zu können. Das ist eines der schwierigsten Aufgaben für uns Menschen.
Was ist meins – was ist das Tier? Wo sehe ich die eigenen Wunden Punkte?
Die eigenen wunden Punkte selbst zu sehen, ist (fast) nicht möglich. Deswegen ist es ja ein wunder Punkt. In unserer Gesellschaft herrscht der Glaube, wie können alles selbst entscheiden und bewältigen – «Das mache ich mit mir aus». Das ist ein sehr unmenschlicher Gedanke. Wir sind soziale Wesen und die wunden Punkte werden von der Gemeinschaft gepflegt und geheilt. Wenn du deine eigenen wunden Punkte kennenlernen willst, empfehle ich den Dialog mit einem Gegenüber. Auch in der Tierkommunikation kann es vorkommen, dass eine vermeintliche Aussage des Tieres nicht vom Tier stammt, sondern dass der wunde Punkt spricht. Ich empfehle dann sehr gut hinzuhören, welche Qualität (Charakter) diese Aussage hat – ist es stimmig, dass mein Tier eine solche Aussage in dieser Art und Weise formuliert? Diese Gegenfrage kann zur Unterscheidung helfen.
Wie erkenne ich, dass ein Tier gehen möchte?
Ja, es ist so, dass Tiere länger irdisch bleiben, weil sie merken, dass der Mensch noch nicht bereit ist, loszulassen. Wir erkennen es, wenn wir sehen, dass sich die Lebensenergie, das Chi, in den Körper zurückzieht. Dies ist in den Augen erkennbar. Der Blick richtet sich langsam nach innen. Das Tier ist apathisch und zeigt wenig oder keine Reaktionen mehr. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht mehr wahrnimmt. Ganz das Gegenteil! Die Sinne sind noch voll da. Wenn wir Menschen uns das tote Tier vorstellen und dies von einem friedlichen Gefühl begleitet wird, dann ist der Moment da, wo das Tier gehen möchte. Es ist ein grosses Geschenk an das Tier, wenn es seinen letzten Lebensmoment selbst bestimmen kann.
Was sind die Merkmale eines Sterbeprozesses? Welche Phase braucht was?
Die Sterbephasen sind nach der Lehre der TCM und der indotibetanischen Lehre beschrieben worden, sind aber auch wieder individuell, vor allem was die Dauer der Phasen betrifft. Wie in meinem letzten Blog-Artikel beschrieben, schlägt Rosina Sonnenschmidt verschiedene Lichtfarben vor, um zu begleiten. Auch gibt es homöopathische Mittel, die unterstützend sind, vor allem in der sog. Feuer-Phase. Es können auch ätherische Öle sein, ein wichtiges Kapitel sind Berührungen. In diesem Punkt finde ich es wichtig, die Präferenzen des eigenen Tieres schon vorher zu kennen. Es sollte im Sterbeprozess nicht durch für es unnötige Rituale, die zwar für den Menschen wichtig sind, nicht aber für das Tier, gestört werden. Auch sollten Berührungen, wenn überhaupt sehr achtsam stattfinden, da sie das Tier im Irdischen halten.
Dies ist der zweite Artikel zum Thema Sterbebegleitung, weitere werden folgen. Ich danke den Teilnehmenden des Kurses für ihre sorgfältige Mitarbeit.
[1] Helsinki Chronic Pain Index: The second English translation of the HCPI: http://www.vetmed.helsinki.fi/english/ animalpain/hcpi/HCPI_E2.pdf; Canine Brief Pain Inventory: https://www.vet.upenn.edu/docs/default-source/VCIC/canine-bpi.pdf?sfvrsn=6fd20eba_0; Glasgow Composite Pain Scale: http://www.isvra.org/PDF/SF-GCPS%20eng%20owner.pdf
[1] https://vetmedbiosci.colostate.edu/vth/wp-content/uploads/sites/7/2020/12/canine-pain-scale.pdf; https://www.the-pac.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/Acute-Pain-Assessment-Scale-For-Dogs-HAG210-1.pdf




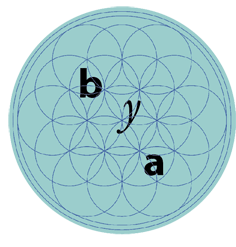





Kommentare